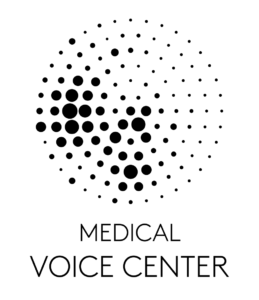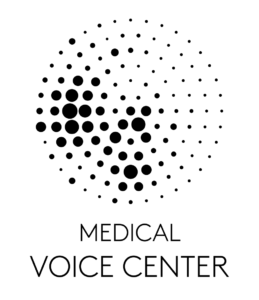Psychogene Stimmstörungen – Was sind das für Probleme?
Die Psyche ist eng mit der Stimme vernetzt. Wie jemand sich fühlt, hören andere an dem Klang der Stimme. Nerven und Muskeln reagieren auf seelische Vorgänge. Psychisch bedingte Stimmstörungen treten oft unvermittelt auf, ohne dass die Betroffenen ihre Stimme übermäßig strapaziert haben. Psychogene Aphonien oder Dysphonien führen zu einem völligen Versagen oder einer starken Einschränkung der Sprechstimmfunktion.
Bei vielen Stimmstörungen spielen die Besonderheiten und Befindlichkeiten des Betroffenen und damit die Wechselbeziehungen zwischen Persönlichkeit und Stimme eine Rolle. In sehr ausgeprägten Fällen spricht man von einer Psychogenen Stimmstörung (Dysphonie). Hauptmerkmal dieser Stimmstörungen ist eine nicht mehr leistungsfähige Stimme.